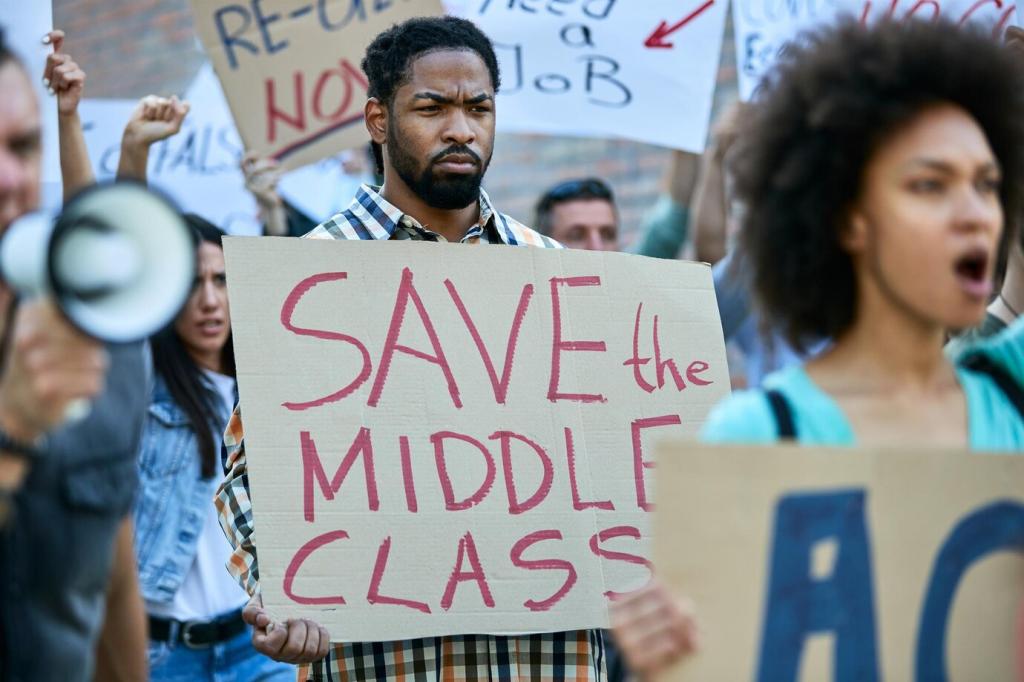Arbeitsanreize, Grenzabgaben und die Gefahr von Transferfallen
Wenn jeder zusätzlich verdiente Euro fast vollständig mit Kürzungen verrechnet wird, entsteht eine hohe effektive Grenzabgabenquote. Das kann Mehrarbeit unattraktiv machen. Sanfte Ausphasungen, Freibeträge und transparente Regeln verringern diese Hürde und verbessern Übergänge in stabilere Beschäftigung.
Arbeitsanreize, Grenzabgaben und die Gefahr von Transferfallen
Leistungen sollten graduell auslaufen, nicht abrupt. Einkommensfreibeträge, gleitende Anrechnungen und zeitlich befristete Boni helfen, die berühmten Klippen zu entschärfen. Wer plant, mehr zu arbeiten, sollte vorab berechnen können, wie sich Nettoeinkommen und Unterstützung tatsächlich verändern.
Arbeitsanreize, Grenzabgaben und die Gefahr von Transferfallen
Mara, alleinerziehend, stand vor der Wahl: Minijob behalten oder Vollzeit wagen. Eine Beratungsstelle rechnete mit ihr die Ausphasung der Leistungen durch. Mit einem Arbeitszuschlag lohnte sich der Wechsel endlich. Kennen Sie ähnliche Situationen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen, damit andere dazulernen.